
Jean Cocteau: "Thomas der Schwindler" - Rezension der Neuübersetzung
Thomas gibt sich wegen einer Namensgleichheit als Neffe eines berühmten Generals aus. Dadurch werden ihm in der Gesellschaft Tür und Tor geöffnet.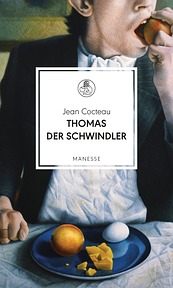
© Manesse Verlag
Der Krieg als großes Spektakel
Wie Iris Radisch in ihrem Nachwort nachgewiesen hat, hat Cocteau selbst an einem solchen Konvoi teilgenommenen, und Teile des Kurzromans sind als autobiografisch aufzufassen. Die auf Dramen ausgerichtete Madame de Borme verzehrt sich geradezu vor Tatendrang, "der Krieg erschien ihr sofort als Theater des Krieges" und das gefährliche Leben war gerade angesagt und hypermodern. Beladen mit Orangen, Keksen und alkoholhaltigen Pralinen, drangen sie "in die Kulissen des Dramas vor. Die Bühne kam näher, und sie betrachteten diese Einsamkeit, die Bäume rechts und links, die von Kanonendonner erfüllte Nacht. Glichen sie nicht jenen Musikliebhabern auf der Galerie, die, über einen schwarzen Abgrund gebeugt, Strawinsky lauschten?" Ohne Zweifel, Cocteau stellt den Krieg als ästhetisches Schauspiel dar, und er lässt nichts unversucht, das kriegerische Treiben zu poetisieren, vor allem, wenn er sich Clémence de Borme zuwendet. Am Rande stehende Passanten sind für sie Schauspieler-Statisten, nur der Gestank der Kulissen stört sie ein wenig, aber sie gewöhnt sich daran wie an einen scheußlichen, aber atemberaubenden Theatereffekt. Nun sollte man aber nicht annehmen, dass hier alles als Spektakel glorifiziert wird. Der Schriftsteller redet auch von narkosefreien Beinamputationen, eingeschlagenen Granaten, zerfetzten Soldaten und einem hoffnungslos versehrten Pferd, das durch seine Eingeweide hinkt. Knallharte Schilderungen, gewiss, doch die Ernsthaftigkeit wird konterkariert durch die Leichtigkeit, mit der diese (von Claudia Kalscheuer neuübersetzten) Sätze daherkommen. Die anfängliche Ästhetisierung hört irgendwann auf, doch komischerweise hat man sich so an sie gewöhnt, dass einem die Schrecken des Krieges viel harmloser vorkommen, als befände man sich in einer Traumwelt. Diese grausamen Bilder und Beschreibungen des Elends wirken trotz ihres Realismus mitunter so fantastisch an, dass sie wie eine willkürliche Aufbauschung wirken.
Thomas verschmilzt mit seiner Rolle
Anfänglich wirkt diese Rettungsgesellschaft wie ein Karnevalsumzug. Viele Einfälle Cocteaus klingen lustig, etwa dass ein Arzt selbstherrlich die Route ändert, um etliche Geranientöpfe in seiner Datsche abzuliefern. Später wird es denn doch etwas ernsthafter. Thomas der Schwindler ist wie eine Eintrittskarte: Dank seinem Namen wird der Konvoi überall vorgelassen, auch in brenzligen Fällen. Längst ist Guillaume Thomas mit seiner Rolle verschmolzen, er setzt Fiktion mit Wirklichkeit gleich und lügt aus Unbekümmertheit und um seiner Rolle gerecht zu werden, was er für legitim hält. Hauptsächlich in dieser Figur steckt einiges von Cocteau, der die interessante, spielerische, ja künstlerische Lüge der Profanität der Wahrheit vorzog. Thomas geht in ein Bataillon und wird dort frenetisch gefeiert, und da Liebe oft Gegenliebe erzeugt, liebt er eben diesen militärischen Verband aufs Innigste, mehr übrigens als Henriette, Tochter von Clémence de Bormes, die ihn auf der Stelle heiraten würde. Es kommt nicht mehr dazu, ihr Liebesbrief erreicht ihn nicht mehr. Thomas, der den Krieg immer noch für ein aufregendes Abenteuer hält, wird von einer Kugel tödlich getroffen. Seine – erstohlene – Legende lebt weiter. Auch wenn ein Arzt seine wahre Identität entdeckt und ihn entlarvt hat - er schweigt, denn es war eine sehr nützliche Lüge. Für Iris Radisch ist "Thomas der Schwindler" eine Auflehnung der Avantgarde gegen den "dumpfen Ernst des 20. Jahrhunderts". Die Avantgarde habe gesiegt. So kann nur eine Ästhetin sprechen. Nein, der Ernst hat gesiegt, und möge er noch so dumpf sein.
Jean Cocteau: Thomas der Schwindler. Übersetzt von Claudia Kalscheuer. Mit einem Nachwort von Iris Radisch. Manesse Verlag, Zürich, 2018. 183 Seiten.
Bildquelle:
W. Zeckai
(Wie macht man eine Lesung erfolgreich?)





