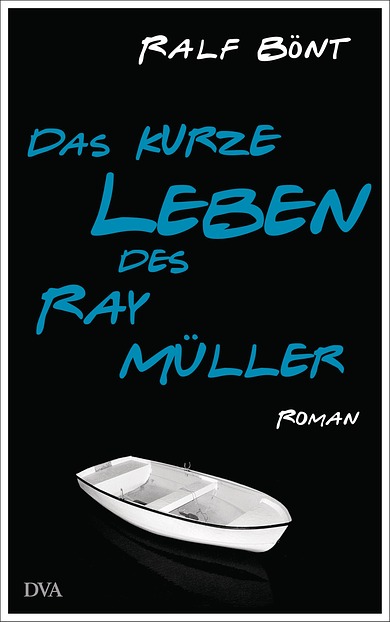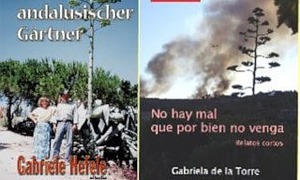Ralf Bönt: "Das kurze Leben des Ray Müller". Rezension
Das Leben der Hauptfigur Marko Kindler ist geprägt von Krankheiten und Schicksalsschlägen. Schließlich flüchtet er mit seinem Kind.Buchcover (Bild: © DVA)
Ein Getriebener in der Identitätskrise
Marko hat ein – auch finanziell - erfolgreiches Romandebüt vorgelegt, ist dann aber von einer Schreibblockade befallen und beschäftigt sich mehr mit den Ärzten, die er primär als Halbwissende und Dilettanten einstuft. Marko und die Konzeptkünstlerin Nelly haben nicht lange gebraucht, um ihre Affinität zueinander zu erkennen, und das liegt nicht nur am Gebrauch des Medikaments Thyroxin und am täglichen Zittern, das für einen Schilddrüsenerkrankten in diesem Stadium typisch sein soll. Sie entdecken eine Art Wesensverwandtschaft, zu der neben der Kunst vor allem der gemeinsame Weltschmerz gehört. Sich oft in den Staaten aufhaltend, taucht Marko ein in die Ekstasen und dunklen Turbulenzen der sich gern auskotzenden Künstlerin, die ihn liebt, aber eigentlich lesbisch ist. Die Frage ist nur: Warum lässt Bönt seinen innerlich wie gelähmten Protagonisten so viel reisen? Teilweise entfaltet er eine lebhafte Aktivität, obwohl er auf dem harten Krankenlager liegen müsste. Marko ist das Musterbeispiel der Velleität. Oberflächlich betrachtet nimmt er einige Dinge in Angriff, aber dennoch ist er ein Getriebener. Den großen Entscheidungen geht er aus dem Weg, nur bei Marginalien geht er tatkräftiger vor. Immerhin schafft er es, sich eine Weile als Gebrauchtwagenhändler über Wasser zu halten, was seiner Frau entschieden missfällt: Sie wollte einen Schriftsteller als Mann haben und keinen, die sich in einer notorischen Identitätskrise befindet. Leider taugt der Roman zur Bestandsaufnahme einer männlichen Identitätskrise fast überhaupt nichts: Marko ist mitnichten ein exemplarischer Typus, der als Repräsentant des ‚neuen' Mannes fungieren könnte.
Chronische Selbstsezierung
Der Schluss ist arg konstruiert, als könne Bönt eine latente Krimi-Neigung in sich nicht unterdrücken. Marko flüchtet mit Ray über Ostdeutschland und säuft im Meer mit einem gekauften Boot ab, wo er dann von einen Hubschrauber mit einer Strickleiter gerettet wird – Ray erstickt dabei. Ein dramatischer Epilog, endend bei einem polizeilichen Verhör. Nun macht es gar keinen Sinn, über die Gründe des Black-outs zu reflektieren – alles kam irgendwie zusammen, auch der Wunsch, das Kind für sich allein zu behalten, ohne Eifersüchteleien von Lycile. Der Versuch, einmal Verantwortung zu übernehmen, scheitert kläglich. Das Negative des Werks – die chronische Selbstsezierung, die zu detaillierten medizinischen Protokollen führt – wendet sich ins Positive, wenn der Blick nach außen geht. Scharfe Beobachtungen der Außenwelt sind die Folge, die aber teilweise verzerrt werden durch krankheitsbedingte Wahrnehmungen. Und die sexuell aufgeladenen Passagen sind nicht gerade die besten, egal ob es sich um Massage- und Bordellszenen, Onanieversuche oder bizarre Phantasien in der U-Bahn handelt, wo seine libidinöse Energie im Imaginativen seine Erfüllung findet. Insgesamt ist es ein Buch, das mitunter fesselt, aber auch zum wütenden Weglegen animiert. Glänzende Passagen wechseln ab mit einem enervierendem Psycho-Brei. Einmal in den Sog der Handlung und der detaillierten nüchternen Sprache geraten, liest man den Roman dennoch begierig bis zum Ende.
Ralf Bönt: Das kurze Leben des Ray Müller. München, DVA 2015, 332 Seiten.
Bildquelle:
W. Zeckai
(Wie macht man eine Lesung erfolgreich?)