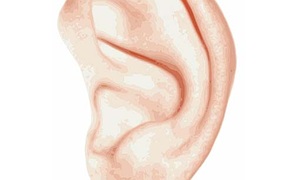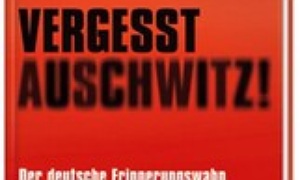Arbeitslosigkeit: die Folgen und Lösungsansätze der Soziologie
Die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf den Betroffenen und welche Lösungen es für das Damoklesschwert Arbeitslosigkeit gibt umschreibt dieser Artikel.Auswirkungen auf die Gesellschaft
In der Gesellschaft ist noch immer der Gedanke von Arbeit als Identitätsmerkmal und Statusmerkmal als Bestandteil der Erziehung, also der Sozialisation verankert. Durch den Verlust eben dieses Status und Identifikationsmerkmals in der Form von Arbeitslosigkeit verlieren die betroffenen Individuen einen Teil ihrer Identität. Die Reaktion ist oftmals ein langsamer Verlust der gewohnten, sozialen Strukturen. Sie werden durch den Umstand der Arbeitslosigkeit mit einer oftmals ungeplanten Situation konfrontiert, auf welche sich die betreffenden Personen kaum adäquat vorbereiten können.
Die sozialwissenschaftliche Studie "Die Arbeitslosen von Marienthal" beschäftigte sich mit dem Thema Langzeitarbeitslosigkeit und untersuchte die Auswirkungen dieser. Die Schließung der örtlichen Fabrik ging mit einem Verlust nahezu sämtlicher Arbeitsplätze in Marienthal einher und die Betroffenen hatten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine Chance mehr auf einen Arbeitsplatz innerhalb ihrer Heimat. Die Langzeitstudie zeigte auf, dass die Folge von Langzeitarbeitslosigkeit nicht etwa Revolte oder Aufbegehren sei, wie erwartet wurde, sondern schlicht und einfach Resignation gekoppelt mit Selbstaufgabe. Neben dem materiellen Verlust, in Form von Einkommen, kam es bei den betroffenen Personen zu einem Verlust der Tagesstruktur und der Zeitplanung. Bei den von Langzeitarbeitslosigkeit Betroffenen kann es zu einem Zeitverfall und zu sinnloser Zeitverschwendung, da sie mit ihrem Übermaß an Zeit nichts mehr anzufangen wussten. Des Weiteren kam es zur Vernachlässigung der sozialen Kontakte, und die Sozialkontakte reduzierten sich nach und nach bis zum Familienkreis.
Zusammenfassend gesagt hat Langzeitarbeitslosigkeit auf die Gesellschaft der Betroffenen eine lähmende, paralysierende, resignierende Wirkung. Der arbeitslose Mensch weiß nichts mehr Sinnvolles mit sich anzufangen und vereinbarte Absprachen, Pflichten, Termine werden nicht mehr wahrgenommen, sind für den Betroffenen ohne Belang. Man versinkt in einem Sumpf aus Wachen. Schlafen, Essen, Verstoffwechseln. Die Zeiträume zwischen diesen Tätigkeiten werden nicht mehr richtig wahrgenommen und verschwimmen fast gänzlich.
Was kann man gegen das Damoklesschwert Arbeitslosigkeit tun?
Auf diese Frage gibt keine allgemein anerkannte Antwort. Die liberale Wirtschaftstheorie sieht die Gründe für Arbeitslosigkeit in unserer Gesellschaft in der starken Reglementierung des Arbeitsmarktes. Den Kollektivverträgen wird beispielsweise die Schuld gegeben Kostentreiber zu sein und als Lösung bietet die liberale Wirtschaftstheorie an, die Macht der Gewerkschaften abzuschwächen und die Kollektivverträge in Richtung der Arbeitgeberinteressen abzuändern, um Kosten zu sparen.
Eine andere Variante wäre die Reduzierung der Lohnnebenkosten (Sozialversicherung). In den 1980er und 1990er Jahren wurde in der Bundesrepublik Deutschland versucht, durch die Kürzung der Normalarbeitszeit die Arbeitslosigkeit zu senken, da nun mehr Arbeitskräfte vonnöten waren. Diese Suppe wurde allerdings durch die höheren Lohnersatzleistungen und Lohnnebenkosten versalzen. Senkte man die Lohnnebenkosten mittels Teilzeitjobs und freien Dienstverträgen, käme es zu einem Anstieg der Arbeitsplätze, da die Arbeitnehmer für den Arbeitgeber nun viel billiger wären.
Den Gegenpol zu dieser Ansicht würde eine Erhöhung der Kaufkraft bilden, was zu einer Steigerung des Wirtschaftswachstums führen würde, einhergehend mit einer Produktionssteigerung, welche Arbeitsplätze schaffen würde. Dennoch, jeder dieser Versuche hatte ein Haar in der Suppe und keiner kam dem Traum der Vollbeschäftigung nahe, was dazu führte, dass von Soziologen seit den 1980er Jahren immer wieder vorgeschlagen wird, dieses Ziel der Vollbeschäftigung zu verwerfen und neue Wege zu gehen und Alternativen zu entwickeln.



Die Idee des Buches entstand aus den zahlreichen Einträgen des Internetportals und zusätzlich aus den vielen Erfahrungen des Autors im Rahmen der Beratung von Existenzgründern. ...

Bildquelle:
Global Unzensiert (Videoausschnitt)
(USA: 2/39 - Techmogule im Juli 2020 zum ersten Mal vor dem Senat im...)