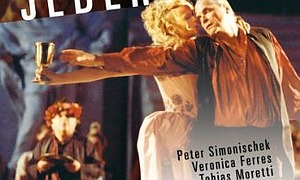Berliner Ensemble: Kritik von "Kaspar" - Sebastian Sommer
Premiere des 68er-Stückes von Peter Handke. Sprache als Herrschaftsinstrument: Sie manipuliert und macht den Menschen gebrauchsfähig.Jörg Thieme als Kaspar (Bild: © Lucie Jansch)

Jörg Thieme, Boris Jacobi
© Lucie Jansch
Ordnung durch Sprache
Die Bühne des Pavillons ist vollgestellt mit unzähligen Tischen, die von den Bühnenarbeitern absichtlich ungeordnet hingewuchtet wurden. Jörg Thieme als Kaspar muss sich zunächst in dieser Rumpelkammer zurechtfinden. Kasper ist in einem gewissen Sinne ein Kaspar Hauser, der irgendwo, womöglich in einem Wald aufgegriffen wurde und nur über ein limitiertes Sprachvermögen verfügt. Auch die Umgangsformen sind verheerend, eine gesellschaftliche Sozialisation hat offensichtlich nicht stattgefunden. Kaspar klammert sich zunächst an den einen Satz: "Ich möchte ein solcher werden wie einmal ein anderer gewesen ist." Das ist reine Selbstbehauptung, die aber immer wieder von außen, von den "Einsagern" angefochten wird. Parallel zur Sprachverunsicherung läuft Kaspars unkontrollierter Ordnungsversuch: Die Aufräumarbeiten geschehen ohne System, die Tischaufstellung ist trotz seines Bemühens noch wirr. In dem Maße, in dem die belehrenden Einflüsterer auf ihn einwirken, werden ihm die Gegenstände sprachlich vertrauter, so dass er sie allmählich zu ordnen lernt. Kaspar scheint sich der Welt anzupassen und kann so auch Ordnung herstellen.

Das Ensemble
© Lucie Jansch
Manipulieren und beherrschen
Die Einsager (Thomas Wittmann, Ursula Höpfner-Tabori, Claudia Burckhardt, Marko Schmidt, Boris Jacoby, Nadine Kiesewalter) erreichen, dass Kaspar mit der "neuen" Sprache umgehen kann. Trotzdem leidet er unter der Übermacht der Einflüsterungen, die sein Gehirn sanft malträtieren. Aber seine Abwehrmechanismen kapitulieren mit der Zeit, er kann sich dem Einfluss von außen nicht länger widersetzen und wird zum Massenmensch. Als solcher funktioniert er vorzüglich: Kaspar stellt alle Tische zu einer ebenen Fläche zusammen, vergleichbar einer großen ungedeckten Tafel. Hier nehmen die Einsager und später auch Teile des Publikums Platz - ein Kollektiv ist herangewachsen. Gewiss wollte Peter Handke den positiven Werkzeugcharakter der Sprache hervorheben. Darüber hinaus kritisiert er aber auch die Sprache als Manipulationsmittel, die teilweise gezielt aus Herrschaftsgründen eingesetzt wird und zudem kategorisiert, katalogisiert und systematisiert, bei Dingen, die manchmal nicht recht zueinander passen wollen. Das Stück wurde 1968 geschrieben, also in einer Zeit, als die aufbegehrenden jungen Menschen sich von gesellschaftlichen und gesetzlichen Zwängen lösen wollten. Dennoch ist "Kaspar" hochaktuell, denn viel hat sich seitdem nicht geändert. Nicht wenige Staaten benutzen die Sprache als Herrschaftsinstrument, um eine Egalisierung herbeizuführen, die die individuellen Belange in den Hintergrund rückt. Und die Gesellschaftsmitglieder kontrollieren sich gegenseitig, damit niemand aus der Reihe tanzt. Egal wie Kaspar sich windet, um gegen die Entindividualisierung zu revoltieren, er ist bereits dermaßen konditioniert und automatisiert, dass er nicht mehr aus der erlernten Sprache ausbrechen kann. Der Dynamik von Jörg Thieme ist es zu verdanken, dass wesentlich mehr als eine bloße Bebilderung des Textes herausgekommen ist. Energiegeladen, wie ein Getriebener hetzt er über die Tische und gesteht sich seine Niederlage ein, die für andere ein Triumph wäre. Er ist nun Massenmensch und hat eine Zugehörigkeit in einer Art Exil gefunden. Bei den Affen und Ziegen.
Kaspar
von Peter Handke
Regie: Sebastian Sommer, Bühne und Kostüme: Johannes Schütz, Dramaturgie: Steffen Sünkel, Licht: Ulrich Eh, Sounddesign: Knut Jensen.
Mit: Jörg Thieme, Thomas Wittmann, Ursula Höpfner-Tabori, Claudia Burckhardt, Marko Schmidt, Boris Jacoby, Nadine Kiesewalter.
Berliner Ensemble, Pavillon
Premiere vom 21. Februar 2014
Dauer: 90 Minuten, keine Pause
Bildquelle:
Ruth Weitz
(Lilli Chapeau und ihr kleinstes Theater der Welt in Miltenberg)