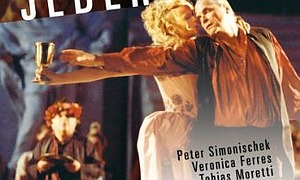Deutsches Theater Berlin: Kritik von "Eisler on the Beach" – Kuttner/Kühnel
Premiere. Diesmal hat sich das Regieduo Kuttner und Kühnel die McCarthy-Ära in den USA vorgenommen. Auf der Anklagebank: Die Brüder Eisler, Hanns und Gerhart.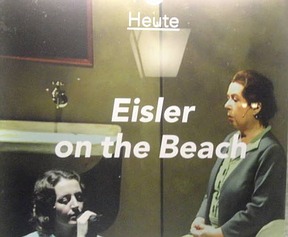
DT-Plakat, Maren Eggert und Simone von Zglinicki
© Steffen Kassel
Unamerikanische Umtriebe des bereits erfolgreichen Komponisten
Musikalische Weihen werden an diesem von viel Gesang bestrittenen Abend nicht zelebriert, aber das Vorgetragene ist immerhin hörbar. Sogar Maren Eggert, die sich gesanglich noch nie hervorgetan hat, fängt an zu singen und zeigt nach vergangenen regiebestimmten Einengungen eine Erweiterung ihrer Bandbreite. Einiges an Text ist original aus dem Off zu hören, und Eggert macht, genauso wie ihre Kollegen, die – durchaus erfrischende – Pantomime dazu. Sie spielt die Schwester Ruth, die sich schon 1926 energisch und weinerlich-emotional mit ihrem kommunistisch und kompositorisch aktiven Bruder Hanns (Ole Lagerpusch) auseinandergesetzt hat. Lagerpusch im Exil agiert und ist gestylt wie ein perfekter Amerikaner, als habe sich das Regieduo im Übermaß alte US-Filme angesehen. Das Live-Gespräch läuft auf Video ab, eingetaucht in die Atmosphäre von Edward Hopper, der maltechnisch den wesentlich biederen DDR-Kunstrealismus ein bisschen vorweggenommen hat. Das sind schöne Sequenzen, beinahe ein bühnenästhetischer Coup. Die visuell ansprechenden Bühnenpräparierungen sind etwas fürs Auge, leider kommt das Ohr etwas zu kurz. Klar, das House Committee on Un-American Activities, wie der Großteil der Bevölkerung aus ehemaligen Nicht-Amerikanern zusammengesetzt, ist hyperaktionistisch, doch die fortwährenden Verhöre und versuchten verbalen Ausquetschungen führen irgendwann zur latenten Ermüdung.
Geschichtsaufbereitung mit viel Musik
Diese Geschichte, untermalt von fortwährender Blasmusik, ist auch eine Rachegeschichte. Die Schwester Ruth, einst kompromisslose Kommunistin, ist seit der Ermordung ihrs Bruders Maslow auf antistalinistischem Kurs und denunziert im hyperventilierenden McCarthy-Klima ihre Brüder, die sich von nun an in der US-Presse abenteuerlichen Verleumdungen ausgesetzt sehen. Das ist alles gut aufbereitet und recht gut recherchiert, lebt aber letztlich von den Schauspielerleistungen und optischen Effekten. Der rauschebärtige, sehr kräftige, gerade noch gelenkige Michael Schweighöfer als Hanns sitzt neben der spionierenden, sich geistig reduziert gebenden Interviewerin Simone von Zglinicki und dem Kellner Daniel Hoevels in einem leicht stilisierten, auf Coolness getrimmten Café, dahinter Bier-Zapfanlagen, die an moderne Gasflaschen erinnern. Rechtfertigungsversuche mit zurückgehaltenen Details auch hier – wer möchte schon mit der Wahrheit herausrücken? Diese Geschichtsaufbereitung für Zuschauer mit Informationslücken ist vor allem deshalb goutierbar, weil die Broadway-affinen technischen Arrangements einigermaßen zünden. Hinzu kommt die Offenlegung einer vorschnellen, fragwürdig interpretierenden Medienlandschaft, die auch heutige Demokratien betreffen, vom provinziellen Kleinorgan bis hin zum Staatsfernsehen. Die Sündenbock-Theorien erleben hier ein Revival, sie stimmen zwar, sind aber furchtbar abgetragen. Zum Glück ist auf der Bühne einiges zu erleben: Pose spielt wie immer Pose mit ein paar neuen Posen und Maren Eggert ist auffallend gut aufgelegt. Jürgen Kuttner, spontan mitunter grandios, fehlt bei der Textkomposition der nicht lange, sondern große Atem. Ein befriedigender Abend, ohne Theaterhöhen zu erreichen.
Eisler on the Beach
Eine kommunistische Familienaufstellung mit Musik
von Tom Kühnel und Jürgen Kuttner
Regie: Tom Kühnel, Jürgen Kuttner, Bühne: Jo Schramm, Kostüme: Daniela Selig, Musik: Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot, Dramaturgie: Claus Caesar.
Mit: Michael Schweighöfer, Simone von Zglinicki, Maren Eggert, Daniel Hoevels, Jürgen Kuttner, Jörg Pose, Ole Lagerpusch.
Musik: Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot.
Deutsches Theater Berlin, Kammerspiele
Premiere vom 12. November 2015
Dauer: ca. 125 Minuten, keine Pause
Bildquelle:
Ruth Weitz
(Lilli Chapeau und ihr kleinstes Theater der Welt in Miltenberg)