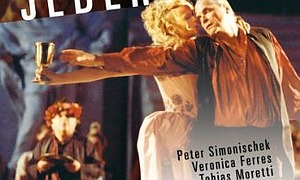Deutsches Theater: Kritik von "Der Untergang des Egoisten Johannes Fatzer"
Premiere vom 12.11.2016. Die Regisseure Kuttner und Kühnel inzenieren Brechts Fragment auf eigenwillige Weise. Die vier Kriegsdeserteure tragen silberne, futuristische Glitzer-Overalls.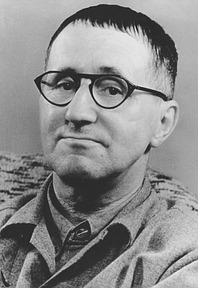
Bertolt Brecht
@ Bundesarchiv / Wikipedia
Warten auf die Revolution
Tom Kühnel und Jürgen Kuttner lassen die Inszenierung sehr unkonventionell angehen. Im Anfang ist erst einmal Kuttner, und nichts außerdem. Eine Introduktion in die Handlung als eine One-Man-Show, wobei der schnoddrige, ebenfalls egotistische Radioexperte seine fragwürdigen bis tatsächlichen Entertainment-Qualitäten auszuspielen sucht. Das Publikum, das rund um die Bühne sitzt – zwei gegenüberliegende Tribünen sind aufgebaut inklusive seitlicher Bestuhlung -, das Publikum darf die Reihenfolge der Fragmente selbst aussuchen. Und so kommt es, dass die chronologische Ordnung völlig über den Haufen geworfen wird. Nur der Schlussteil, die Hinrichtung des "Verräters" Fatzer, seht felsenfest am Ende des Stückes. Zwischen Fatzer (Andreas Döhler), Koch (Bernd Stempel), Büsching (Alexander Khuon) und Kaumann (Edgar Eckert) agiert die Gastgeberin Natalie Seelig, die phasenweise gern mal mit sonorer, kehliger Stimme singt und dabei irgendwo zwischen Marlene Dietrich und Amanda Lear einzuordnen ist. Das ideologisch genährte Abwarten der Revolution hat nur einen gewaltigen Haken: Fatzer. Der muss als auserkorener Wortführer mit vier Lungen atmen, übernimmt aber ob seines selbstsüchtigen Wesens keinerlei Verantwortung. Andreas Döhler spielt das ideologisch wackelige Großmaul, das seinen Unmut förmlich ausspuckt, auch mit feuchter Aussprache.
Untätiges Eingeschlossensein
Die Darsteller*innen tragen allesamt bizarre Expeditions- oder Raumfahrtanzüge, vermutlich überzeitlich. Denn hier hat Brecht offensichtlich ein Phänomen behandelt, das über allen Zeiten steht: Das individualistische Aussprengen aus dem Kollektiv, jegliche größere Bewegung konterkarierend. Mit einer solchen futuristischen Glitzeraufmachung hat sich Döhler auch auf die Warschauer Brücke begeben, die Friedrichshain mit Kreuzberg verbindet. Ein eingespieltes Video zeigt es: Döhler, an einer existentiellen Grenzsituation angelangt, brüllt berlinernd seinen Hungerschmerz heraus, windet sich auf dem Boden, und das vor unbeteiligten Passanten mit fragendem Gesicht. Inbegriffen ist eine Anklage der achso bösen Welt, die ihre Lungen nur für sich selbst beansprucht. In einer anderen Szene sind die vier Verweigerer in einer transparenten Raumkapsel eingeschlossen – ähnlich wie bei verglasten Drehtüren in Verkaufspassagen -, als wollten sie sich noch einmal ihrer gemeinsamen Kraft versichern. In Wahrheit ist das untätige Eingschlossensein in der Wohnung ein Verhängis. Das Nichtzustandekommen der Revolution führt letztlich zur Selbstzerfleischung, die von den Regisseuren relativ zart, ja domestiziert abgehandelt wird. Der revolutionäre Stachel sitzt noch bei Koch und Büsching, bei Fatzer ist er bereits in einem Maße abgestumpft, dass er die unterversorgte Rossette von Kaumanns Gattin ungestüm penetriert. Incipit tragoedia! Das ist zuviel des Guten, am Ende wird er von seinen Kumpels hingerichtet. Die Schauspieler nehmen eine Sitzbank aus dem Publikum, umwickeln den draufgespannten Fatzer mit Hartfolie und ziehen ihn in die Höhe. Nun, Brecht hat sich ein solches "Lehrstück" auch ohne Zuschauer*innen gedacht. An diesem Abend geschieht das krasse Gegenteil. Sie werden zu Mitmachenden in einem vermixten Wechselprozess. Texte werden an die Leinwand geworfen, der dann im Chor in den Kammerspielen widerhallt. Dadurch herrscht eine gleichsam intimere Atmosphäre, als seien alle Anwesenden involviert. Und die Situation macht sich der überengagierte Döhler zunutze. Er geht ins Publikum, baut sich vor dem verblüfften Schaubühnen-Gast Jule Böwe auf und schmettert ihr eine Wutrede entgegen. Es ist also eine sehr luftige Angelegenheit, vor allem wegen der Improvisationen. Dieser schwebenden Leichtigkeit fehlt am Ende doch ein wenig die Stringenz.
Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer
von Bertolt Brecht
Fassung Tom Kühnel und Jürgen Kuttner
Regie: Tom Kühnel, Jürgen Kuttner, Bühne: Jo Schramm, Kostüme: Daniela Selig, Musik: Ornament & Verbrechen, Video: Marlene Blumert, Dramaturgie: Juliane Koepp.
Mit: Jürgen Kuttner, Alexander Khuon Andreas Döhler, Edgar Eckert, Bernd Stempel, Natali Seelig.
Deutsches Theater Kammerspiele, Premiere vom 12. November 2016
Dauer: ca. 135 Minuten, keine Pause
Bildquelle:
Ruth Weitz
(Lilli Chapeau und ihr kleinstes Theater der Welt in Miltenberg)