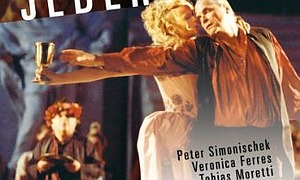Gorki Theater Berlin: Kritik von "Mania" - Miloš Lolić
Premiere. Der Regisseur Lolić orientiert sich an "Die Bakchen" von Euripides. Laute, brummende Techno-Musik übermalt das Schicksal von Dionysos.Die Freuden des Rausches (Bild: © Esra Rotthoff)
Ekstatisch verzückt im Kollektiv
Es dominiert eine wabernde Club-Atmosphäre, die mit gleichsam chthonischen Ritualen angereichert ist. Damit ist offensichtlich ein jüngeres Publikum anvisiert, ohne Rücksicht auf ältere Jahrgänge, die aus Selbstschonungsgründen seit langem keinen Club mehr betreten und andere, feinnervigere Klänge favorisieren. Till Wonka als Dionysos kämpft umsonst gegen den Lärm an, zum Glück gibt es eine an die Seitenwand geworfene englische Übersetzung. Viel hat dieser Dionysos nicht zu berichten, zunächst beginnt er mit seiner von Zeus inaugurierten göttlichen Abstammung, dann schwafelt er vom Kult des Rausches. Sein Gegenspieler ist der weltliche Herrscher Pentheus (Aleksandar Radenković), der, nüchtern und sachlich, auf die Vernunft setzt, quasi auf die instrumentelle Vernunft, aber diesen Ausdruck gab es damals noch nicht. Simplifiziert, gemäß Nietzsche: Das Apollinische gegen des Dionysische, die rationale Besonnenheit gegen die rauschhafte Entgrenzung. Dionysos hat die besseren Karten – wer möchte nicht lieber ekstatisch verzückt in ein selbstverlorenes Kollektiv eintreten, das, von einem starken Wir-Gefühl erfasst, beinahe metaphysische Weihen empfängt? Der Rationalist Pentheus steht eher für die Individuation, für Ordnung und Gesetz. Aber die Vernunft – so der Lauf der Weltgeschichte – unterliegt oftmals den ungestümen Trieben, die nach möglichst ausgreifender Entladung drängen, ohne an die Kater-Phase zu denken.
Rausch gegen Vernunft
Unruhe herrscht in Theben, seitdem sich Pentheus gegen den Ratschlag von Augur Teiresias (Kostis Kallivretakis) entschlossen hat, gegen Dionysos und seine Bakchen militärisch vorzugehen. Sie entkommen der Gefangenschaft und versammeln sich in der gebirgigen Peripherie, wo weinstimulierte Zusammenkünfte arrangiert werden, die die in den Katakomben des Urchristentums stattfindenden Orgien vorwegnehmen. Dort lauert der verkleidete Pentheus auf einem Beobachtungsposten, der ihn zum Verhängnis wird. Die Mänaden zerreisen ihn, darunter seine Mutter Agaue (Sesede Terziyan), die sich beim Zerrupfen und Zerstückeln des Opfers besonders hervortut. Das ist das Ergebnis, wenn Gäste als Fremdlinge abqualifiziert werden. Ein plumper Machtkampf, und der Rauschverkünder göttlichen Ursprungs hatte nie Probleme, Leute zu rekrutieren und ihnen einen Wahn einzupflanzen, der sie gegen Anfechtungen von außen immunisiert. Selbstverständlich ist die Angelegenheit sehr physisch. Die Schauspieler treten mit einer fleischfarbenen Sekundärhaut auf und lassen einige Körperstellen frei, damit eine Kuschel-Choreografie besonders gut zu Geltung kommt. Nach Ablauf einiger widerständiger Kampfposen setzt ein Schmusebetrieb ein, der die Wonnen einer visionären metaphysischen Verschmelzungswelt offeriert. Doch nur von kurzer Dauer: Von oben kommt eine klebrige Flüssigkeit herunter, die die Schauspieler mit einem fettigen Glanz überzieht, der sich vorzüglich fürs Schlamm-Catchen eignet. Geht es nicht immer um den Widerstand der Kräfte? Gut, das ist Heraklit, aber fiel mehr fiel dem Regisseur, der das Geräuschvolle übers Sensible setzt, zu diesem Thema auch nicht ein.
Mania
nach "Die Bakchen" von Euripides,
Übersetzt von Simon Werle
Regie: Miloš Lolić, Bühne: Evi Bauer, Kostüme: Jelena Miletić, Sound & Musik: Lars Wittershagen, Dramaturgie: Holger Kuhla.
Mit: Sesede Terziyan, Aram Tafreshian, Till Wonka, Aleksandar Radenković, Dejan Bućin, Kostis Kallivretakis, Frank Seppeler.
Premiere vom 5.Juni 2015
Dauer: 1 Stunde 20 Minuten.
Bildquelle:
Ruth Weitz
(Lilli Chapeau und ihr kleinstes Theater der Welt in Miltenberg)