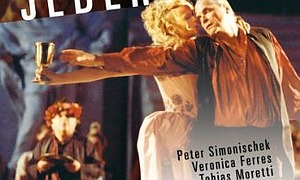Schaubühne Berlin: Kritik von "Ödipus der Tyrann" - Romeo Castellucci
Premiere. Eine Inszenierung nach Sophokles und Hölderlin. Der Regisseur Castellucci vermischt das Griechentum mit dem Christentum.Ursina Lardi (rechts) als Ödipus (Bild: © Arno Declair)
Ein Gespenst geht um
Castellucci bringt ein Klosterleben auf die Bühne, mit dem man viele Menschen jagen kann. Streng sind die Regeln, denen sich die Nonnen freiwillig unterordnen, als berechtige die Ausschaltung aller Bedürfnisse für Höheres. Aber ein Gespenst geht um in Theben - das Gespenst der Seuche. Eine Leiche wird aufgebahrt, ein Sarg bestimmt die Szenerie. Auf der abgeschotteten Glaubensburg lastet ein Fluch, sie ist eben doch nicht hermetisch. Die von Angela Winkler gespielte Chorführerin scheint ein Art Vorzugstellung zu besitzen, gebärdet sich als stillschweigend hingenommene Matriarchin und liest in einem Sophokles-Buch von Hölderlin. Nun findet eine Verwandlung statt, auf der Bühne ersteht eine Mischform aus Palast und Kapelle. Auf einer Empore steht heroisch Ödipus, gewandt, selbstsicher und routiniert. Es ist Ursina Lardi, die wie eine strahlende Göttin leuchtet, mit erhabenem Antlitz, hellem Augenglanz und entblößtem Busen. Aber der weibliche Ödipus hat seinen Kamarilla-Boss und Mitregenten Kreon (Jule Böwe) am Hals, der zusammen mit dem Propheten Tiresias (Bernardo Arias Porras) immer wieder den Mord an seinem Vater Laios andeutet.

Bernardo Arias Porras
© Arno Declair
Willkürliche Vermixung
Tiresias wirkt wie ein heruntergekommener Nomade aus der Wüste, mittlerweile zu Kreuze gekrochen. Schmutzig wie nach einem Schlammbad, trägt er einen Fellrock und gleicht einem Satyr, der Dionysos in bacchantischen Wirren abhandengekommen ist. Egal, wie Ödipus sich windet, die Vermutung, dass er Vatermörder und Inzesttäter ist, wird immer wahrscheinlicher, bis hin zur Erkenntnis. Nun scheint die Sternstunde für Castellucci gekommen. Auf der Bühnenwand sehen die Zuschauer ein Video, in dem sich der Regisseur nach einer Reizgasattacke die Augen reibt. Ödipus stich sich nicht selbst die Auge aus, er reibt sie sich fast zu Tode. Das ist die moderne Version des Ödipus, die ganz nach einer gewaltsamen Polit-Demo aussieht. Leider ist Castelluccis Oszillieren zwischen Gegenwart und einer nicht näher definierten prähistorischen Zeit nicht sonderlich verständlich. Immerhin muss Ödipus für seine ihm unbewussten Elternvergehen Buße tun, indem er sich bei den Klosterfrauen einreiht. Aber was haben die aus Lebensfülle agierenden, der Schönheit verpflichteten Griechen mit einem Christentum zu schaffen, das Entsagung zum obersten Lebensprinzip erhoben hat? Castellucci hat die Ausstellung der Langsamkeit wiederentdeckt. Die Figuren verhalten sich weitgehend statisch und deklamieren vor sich hin, als stünden sie auf einem Podest. Ödipus verkündet seine Worte wie von einem Berg herab, gleitet dann auf den anderen Figuren die Treppe herunter. Es ist ein sehr sinnlicher, irisierender Ödipus, der noch den Höhepunkt bildet bei einer Inszenierung, die, hochästhetisch und ohne jeglichen Humor angelegt, zwei von einander getrennte Welten willkürlich miteinander vermixt.
Ödipus der Tyrann
nach Sophokles / Friedrich Hölderlin
Regie, Bühne und Kostüme: Romeo Castellucci, Künstlerische Mitarbeit: Silvia Costa, Mitarbeit Bühne: Mechthild Feuerstein, Musik: Scott Gibbons, Video: Jake Witlen, Dramaturgie: Piersandra Di Matteo, Florian Borchmeyer, Licht: Erich Schneider.
Mit: Ursina Lardi, Angela Winkler, Bernardo Arias Porras, Jule Böwe, Iris Becher, Rosabel Huguet. Und ein Chor.
Premiere vom 6.März 2015
Dauer: 120 Minuten, keine Pause.
Bildquelle:
Ruth Weitz
(Lilli Chapeau und ihr kleinstes Theater der Welt in Miltenberg)