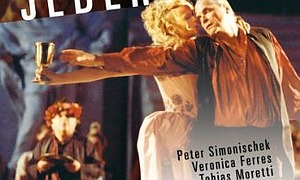Schaubühne Berlin: "Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs". Kritik – Rau
Premiere im Globe Theater. Eine theatrale Reportage über die desaströsen Verhältnisse in Afrika. Ist der Westen für Genozid und Ausbeutung in Afrika verantwortlich zu machen?Ursina Lardi, mitten im Müll und live auf Video (Bild: © Daniel Seiffert)
Die Festung Europa und ihre wirtschaftlichen Vergehen
Auf der Bühne agieren die Belgierin Consolate Sipérius und die immer populärer werdende, leinwanderprobte Helvetierin Ursina Lardi. Eine Interaktion findet nicht statt, beide monologisieren. Sipérius, die ihre Wurzeln in Burundi hat und dort als Kind einen ethnisch bedingten Völkermord miterlebte, übernimmt den Anfang und das Ende. Auch sie zieht, so will es der Regisseur, die westlichen Wirtschaftskolonisatoren in die blutige Mitverantwortung. Rachegelüste steigen auf, euphemistisch ausgedrückt eine Nemesis. Ursina Lardi, die eine junge Entwicklungshelferin und Lehrerin spielt und zwischen Betroffenheit und Zynismus hin– und herschwankt, liefert rein mimisch eine grandiose, bezaubernde Performance ab. Das ist eine neue Akzentuierung des auf sachliche Nüchternheit setzenden Dokumentationsspezialisten Milo Rau, der selbstverständlich mit Lardi eine wochenlange Recherchetournee in besagte Krisengebiete absolviert hat, nur um seine vorgefasste Meinung bestätigt zu sehen. Der Ankläger der "Festung Europa" kommt einem vor, als wolle er auf einen fahrenden Zug aufspringen. Besser: Er läuft einem abgefahrenen Zug hinterher. Milo Rau prangert Zustände an, die bereits in den 80er-Jahren von der deutschen Linken lebhaft diskutiert wurden: Deutschland, das westliche Europa tragen ihren Wohlstand auf dem Rücken Afrikas aus. Der kritische Intellektuelle Milo Rau versucht nicht nur einen Reload zu liefern, sondern einen um einige Einsichten erweiterten Update.
Ursina Lardi (Bild: © Daniel Seiffert)
Mitten im Müll
In einigen Punkten hat er durchaus Recht. Die Coltan- und Kupferförderung mit Hilfe von afrikanischen Mimimallohnempfängern ist tatsächlich eine moderne Form der Ausbeutung, zumal die Produkte anschließend um das Dutzendfache zu Weltmarkpreisen verkauft werden. Die immer wieder erwähnten nichtstaatlichen Hilfsorganisationen (NGOs), altruistisch und egoistisch zugleich, mögen zwar den Einheimischen wie annexionsunwillige Kolonisatoren vorkommen, aber sie versuchen auch mit ihren lebenslaufsstärkenden Aktivitäten eine Teilverwaltung der Ordnung zu organisieren. Milo Rau, der NGO-Beschäftigte hauptsächlich diskreditiert, fordert authentisches Mitleid, keine ästhetisierten Betroffenheitsgesten. Er kritisiert das oberflächliche aktuelle politische Theater und glaubt, mit seiner Theatervariante etwas Glaubwürdigeres geschaffen zu haben. Ursina Lardi, die wie nach einem Massaker mitten im Müll steht und die Wirklichkeit teilweise ausblendet, ist aber durch ihre hinreißende, hohe Schauspielkunst ein Ästhetisierungsphänomen, das differenziert strukturierte Zuschauer zwar zu goutieren vermögen, aber die eigentlichen politischen Pläne und Bedürfnisse des eminent auskunftsfreudigen, pressegierigen Regisseurs konterkariert. Kurz: Rau sucht seine wirtschaftspolitischen Vorwürfe durch Kunst zu verbrämen und macht im Grunde genau das, was er an Kollegen kritisiert. Die am Ende urinierende Ursina Lardi sieht man doppelt: Einmal live auf der Bühne und dann in Großformat auf Video. Wen ein already-heard-Erlebnis überkommt, der kann sich wenigstens an ihrem meistens gelungenen Zusammenspiel von Gestik und Gesagtem erfreuen. Insgesamt ein zwiespältiger Abend.
Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs
von Milo Rau
Regie: Milo Rau, Bühne und Kostüme: Anton Lukas, Video und Sound: Marc Stephan, Dramaturgie: Florian Borchmeyer, Mitarbeit Recherche/Dramaturgie: Mirjam Knapp, Stefan Bläske, Licht: Erich Schneider.
Mit: Ursina Lardi, Consolate Sipérius.
Schaubühne Berlin
Premiere vom 16. Januar 2016
Dauer: 100 Minuten, keine Pause
Bildquelle:
Ruth Weitz
(Lilli Chapeau und ihr kleinstes Theater der Welt in Miltenberg)